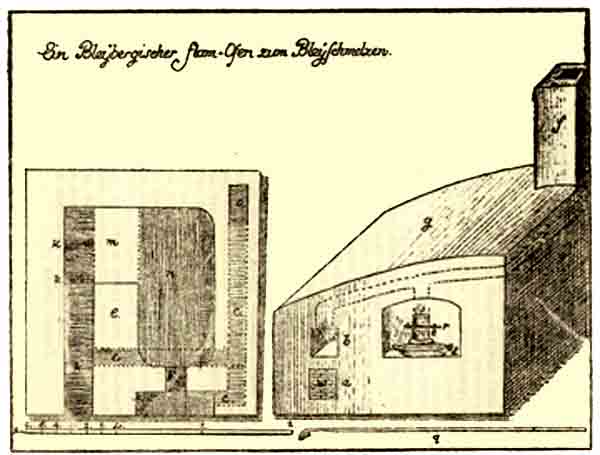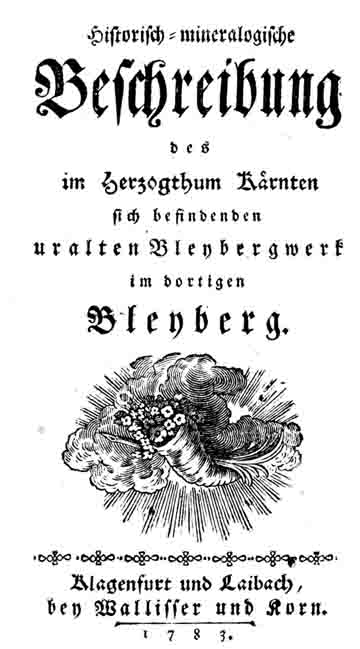Beschreibung des Bleybergwerkes zu
Bleyberg bey Villach in Kärnten.Geschichte,
Mineralvorkommen, Bergbau und Hüttenwesen in einer Darstellung aus dem Jahre
1783, von K. v. P!oyer (?).
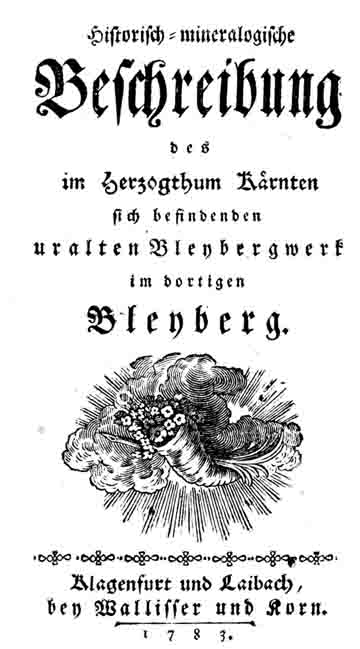
Titelseite zum Buch
Vorwort:
In diesem Jahre erschien ein 83 Seiten starkes
Büchlein (Format: 16 x 10 cm) unter dem Titel: II Fragmente zur
mineralogisch und Botanischen Geschichte Steyermarks und Kärnthens. Altes
Stück. Mit Kupfern. Klagenfurth und Laibach, bey Walliser und Korn .1783 ."
Verfasser ist keiner genannt. Offenbar war dieses Büchlein als der erste
Band einer periodischen Schrift gedacht, wie sie zu jener Zeit üblich waren
und Aufsätze. verschiedener Verfasser vereinigen. Manche dieser
„Jahrbücher", „Journale", usw. brachten es auf eine Reihe von Bänden, hier
ist es beim „lsten" ...geblieben. Es enthält drei Aufsätze:
1) "Tagebuch einer Reise nach den Reichenauer Alpen.
Im Jahre 1782". Seite 3-18.
2) "Tagebuch einer Reise nach der Stangalpe unweit
Turrach in Steyermarck, vom Jahre 1779." Seite 19-33. Beide Aufsätze, die im
wesentlichen botanischen Inhalts sind erscheinen mit S.V.H. unterzeichnet
und stammen zweifellos aus der Feder des verdienstvollen Kärntner
Naturforschers Sigismund von Hohenwart (1745-1825), des nachmaligen Bischofs
von Linz.
3) "Beschreibung des Bleybergwerks zu Bleyberg bei
Villach in Kärnthen. „Seite 34-83, mit 1 Tabelle und 1 Kupfertafel. Bei
diesem Aufsatz fehlt jeder Hinweis auf den Verfasser. Robert R. v. Srbik
("Geologische Bibliographie der Ostalpen von Graubünden bis Kärnten.
München-Berlin 1935) schreibt diese Schilderung der damaligen
mineralogisch-bergbaulich-hüttenmännischen Verhältnisse um Bleiberg dem
bekannten Oberkäntner Bergmann Karl von Ployer zu, welcher Ansicht wir uns
anschließen. Trotz mancher, den Kirchenbesitz betreffender historischer
Angaben ist es unwahrscheinlich, daß der Kleriker Hohenwart auch der
Verfasser des dritten Aufsatzes ist: erstens hätte er ihn dann wohl auch mit
"S.V.H." gezeichnet, zweitens unterscheidet der dritte sich in der
Schreibweise erheblich von den beiden ersten, und drittens ist dem in Gurk
und Klagenfurt tätigen Seelsorger und Naturforscher eine so eingehende
Kenntnis der bergbaulichen und hüttentechnischen Verhältnisse Bleibergs
nicht zuzumuten. Der Verfasser beabsichtigte (vgl. S. 37), falls dieser
Aufsatz entsprechende Aufnahme fände, auch "mit guter Muße" die Beschreibung
der übrigen Bergwerke Kärntens zu unternehmen. Ein Plan, der leider nicht
zur Ausführung gekommen ist. Da das vorliegende Büchlein heute so gut wie
unbekannt und wohl nur in wenigen Bibliotheken vorhanden ist, Ployers
Beschreibung des Bleiberger Bergwerks aber auch heute für jeden Kärntner
Mineralogen, Berg- und Hüttenmann von Interesse sein dürfte, soll hier in
einigen Folgen ein Wiederabdruck in der altertümlichen, oft sehr wechselnden
Original-Schreibweise erfolgen. Die Seitenzahlen des Originaldruckes sind am
Rande beigefügt, die Original-Zeilen durch Schrägstriche (I) von einander
getrennt. In beigesetzten Fußnoten sind einige sinnstörende Druckfehler
berichtigt. Der Steiermärkischen Landesbibliothek Joanneum in Graz, die uns
das kostbare Büchlein (Signatur 10564 ) leihweise zur Verfügung stellte, sei
auch hier bestens gedankt. Wir wollen den Wiederabdruck in 4 Folgen bringen:
1. Einleitung und Geschichte. (Orig.-Seite 34-53) 2. Bergbau. (Origl-0-Seite
53-59) 3. Geologischer Aufbau und Mineral vorkommen. (Orig. -Seite 59-71) 4.
Verhüttung. (Orig.-Seite 71-83, 1 Kupfertafel).
Dr. Adolf und Dr. Heinz Meixner.
Einleitung und Geschichte:
Seite 34. mit so großem Eifer der Bergbau auch/
vorhin in Kärnthen betrieben wurde,/ so wenig waren doch ihre Bergwerke noch
/ vor kurzem selbst bey ihren angränzenden / Nachbarn bekannt. Erst vor
einigen Jahren brachten eini-/ ge seltene Natursprodukte, die die Mine-/
ralienkabineter vorzüglich zierten, diese Pro/ vinz dergestalt in Ruf, daß
seithero kein ein-/ ziger reisender Mineralog diese Landschaft / und ihre
Bergwerke unbesucht gelassen hat. So sehr die seltenen Mineralprodukten, /
die, gleichwie der opalisirende Muschelmar/ mor, mit besonderer Gierigkeit
gesammelt / werden, zum Beweiß dienen, daß die Mut -/ ter Natur mit
Vertheilung ihrer Gaben sich / gegen diesem Lande vorzüglich freygebig er/
wiesen, eben so sehr sind die Größe /. ..der Ver/ hauungen und die Menge der
Gruben ein / untrügliches
35. Zeugniß des Alters der Berg. In werke und des dazumal herrschenden
Bergbau/ geistes der Einwohner. Es ist kein Gebürg in ganz Kärnthen, / wo
man nicht eine Menge verfallener Gru-/ ben und Spuren eines ehemaligen
Berg-/ baues antrifft. Viele Ortschaften, als / Dellach, Obervellach,
Saxenburg, Stein/ feld u. s. w. haben demselben nicht allein/ ihr Aufkommen,
sondern auch wahrscheinli-/ cherweise ihren ersten Ursprung zu danken, / und
ihr Schicksal stunde jederzeit mit dem / Flor und mit dem Verfall ihres
Bergbaues / in der genauesten Verbindung. Hätte zur Zeit der Reformation der
/ Duldungsgeis die Häupter der Christenheit / belebet, wie er dermalen in
unserm grossen / Joseph zum Heil seiner Staaten und Ruhe/ der Menschen
erschienen; so würden die Pro-/ vinzen nicht unglücklicherweise entvölkert
und / der Staat in einen unersetzlichen Schaden / versetzt worden seyn. Den
grössten Nachtheil haben dabey un/ streitig die Bergwerke erlitten. Die
meisten / Gewerken und Knappen emigrirten oder / wurden zu emigriren
gezwungen; die Werker / kamen dadurch in Verfall; die Gruben wr / den durch
den Zufluß der Wässer ertränkt;/ die Baulust entflohe mit denen Gewerken /
und Knappen, und kaum wurden noch eini-/ ge beträchtlichere Werker sehr
nachlässig von / unbergmännischen Händen "betrieben, da
36. in-./. dessen die meisten übrigen in
vollkommenen / Verfall und gänzliche Vergessenheit geriethen. Es ist anbey
zu bedauern, daß in die/ sen verwirrten Zeiten auch die Schriften
und/Dokumenten, die das Alter und den Zustand / der damaligen Bergwerke
betrafen / verlohren / gegangen, wodurch der Zeitpunkt ihres Ur-/sprungs in
einem undurchdringlichen Nebel / verborgen bleibt. Unter denjenigen
Bergwerken, die we-/ gen der Menge der Gruben, und der Weit-/ läufigkeit und
Grösse der Verhauungen das / Gepräg eines hohen Alters bey sich führen, /
und ihrem Untergange wegen beständig abge-/ worfener Ausbeut entrissen
worden, verdient / vorzüglich den ersten Platz das vormalige / Silber- und
dermalige Eisenbergwerk am / Geißberg zu Frießach. Hemma, die Gemah-/ linn
des Grafens zu Frießach und Kaiser / Heinrichs des Vierten Muhme hat hier
Berg / gebauet, und als Sie ihre zwey Söhne ver-/ lohren, die; wie die
Geschichte saget , von / denen Bergknappen erschlagen wurden, stifi-/ tete
Sie das Bistum Gurgg, allwo Sie in / der Domkirche in einem prächtigen r
unterirr-/ dischen Mausoläo begraben lieget. Obwohlen die übrige Bergwerke
kein so / deutliches Zeugniß ihres Alters aufweisen / können; so läßt sich
doch aus der Grösse/ und Weitschichtigkeit des Gebirgs in Hütten-/berg ,
37. aus der Menge der Gruben in Bley -./. berg, und
aus der Mächtigkeit der Verhau-/ ungen in Raibl wahrscheinlicherweise
schlies-/ sen, daß diese Werke eben nicht viel jünger / als das
Frießachische seyn können; ohne ei-/ ne Meldung von dem (ehmaligen reichen
Gold-/ bergwerk in Großkirchheim, und Kupfer/ und Silberbergwerken zu
Obervellach zu ma-/ chen, deren Alter eben; falls weit in die vori-/ gen
Zeiten hineinreichet. Wir wollen uns aber auf die Untersu-/ chung dieses
Gegenstande dermalen nicht ein -/ lassen, sondern mein Zweck ist, das
Bleybergwerk Bleyberg unweit Villach nach allen / ihren Umständen zu
beschreiben, und die / Aufnahme dieses Versuchs abzuwarten, wel-/ che
entscheiden wird, ob ich es wagen dürf-/ fe, auch die Beschreibung der
übrigen Wer-/ ker mit guter Musse zu unternehmen. Wenn man von Klagenfurt
nach Vil-/ lach reiset, öfnen sich, sobald man diese / letztere Stadt zu
Gesicht bekommt, ausser / derselben gegen Abend 3. Thäler, welche /
mitsammen ein paralelelles Streichen von / Morgen gegen Abend haben, von
Villach / iaber, als gleichsam aus ihrem Mittelpunkt / sich vertheilen. Das
Rechtseitige ist das / Traathal, wodurch der Traafluß ,das Link -/ seitige
aber das Gailthal, wodurch der Gailfluß flieset, welche beyde Flüße sich
eine / kleine Strecke unter
38. Villach mitsammen ver-./. einigen. Das mittlere
Thal zwischen bey-/ den, ist das Bleybergerthal. Es ist um / ein
beträchtliches höher als die beyden be-/ meldten Seitenthäler, indem,der
Mittelstand / des Barometers am Ufer des Traaflusses 26, / in Bleyberg
hingegen 25 Zoll beträgt. Die-/ ses Thal wird von zweyen.Gebürgen fori-/mirt,
deren,das rechtseitige seinen Lauf / am / linken Ufer des Traaflusses nimmt,
und die -/ sen Fluß bis ins Tyrol bgleitett auch in / seinem weitern Lauf zu
Ende des Bleyber- / gerthals das Mittelgebürg zwischen dem / Traa und
Gailthale ausmachet. Dieses Gebürg ist nun das Erztgebürg, / worauf man in
seinem ganzen Streichen / bis Tyrol durchgehends Bleyspuren und vie-/ le
alte Gruben findet, und wo auch noch / dermalen an einigen Orten im Gailthal
auf / Bley gebauet wird. Das Linkseitige hinge-/ gen ist ein ganz
freystehendes, beynahe noch / einmal so hohes Gebürg als das.rechtseitige /
Erztgebürg. Der Barometer fällt auf selben / bis 22.2) Zoll. Es ist von
Villach aus, nem-/ lich von seinem Fuß, biß zu dem Schloß / Wasserleonburg,
wo ein Querthal von Mit-/ ternacht nach Mittag dieses Gebürg abschnei-/ det,
und das Bleybergerthal an seinem En-/ de mit dem Gailthale vereiniget, 5.
Stunden / lang. Man kann dieses Gebürg mit Recht / unter die hohen Gebürge
Kärnthens zählen. /
39. Die mittägliche Seite dieses Bergs oder der ./. Abhang ins Gailthal ist
ausserordentlich steil, / und an manchen Orten ganz senkrecht, wel-/ ches
von oben herab schreckbar anzusehen ist / Wie die Jahrbücher erzählen, haben
sich / von dieser Seite des Bergs Ao. 1345. durch / ein heftiges Erdbeben
ausserordentlich grosse / Massen loßgerissen, und in das Gailthal ge-/
stürzt. Von dem Schutt sollen Dörfer, / Menschen, und Vieh verschüttet, und
der / Lauf des Flusses gehemmt worden seyn, den / "gewaltigen Einsturz des
Bergs sieht man / noch deutlich an verschiedenen Orten, und es / machen sich
noch von Zeit zu Zeit grosse La-/ gen los, die noch dermalen nachstürzen,
und / frische Brüche verursachen. Dieser Berg / wird die Villacheralpe
genannt. Das Bleybergerthal streicht von Mor-/ gen gegen Abend, wird aber,
wie ich schon / gesagt habe, am Ende der Villacheralpe von / einem Querthale
abgeschnitten, und dadurch / mit dem Gailthale vereiniget. Das ganze Thal
Bleyberg gehört mit / Grund und Boden, und mit dem Landge-/ richt unter das
Burgamt Villach. Dieses / Burgamt, wie auch die Stadt Villach ge-/ hörten
vormals unter die bischöflich. Bam-/ bergischen Güter in Kärnthen, die das "
Bis-/ tum durch die Schenkung Heinrichs und Ku-/ nigunds erhalten, und durch
einen Vicedom / vorwalten liessen. Im Jahr
40. 1759. wurden / diese Güter dem Bischof wieder abgelöst, -./. Und von dem
Winnerischen Banco käuflich / übernommen, im Jahre 1769. aber das /
Berggericht sammt dem Bergwerk der Di-/ rection und Jurisdiction einer K.K.
Hof-/ kammer in Monetariis et Montanisticis über-/ geben, wobey sich jedoch
das Banco wegen / dem ausgelegten Kaufschilling die Frohnge-/ fälle
vorbehielte, und zu richtiger Abliefe-/rung derselben einen eigenen
Frohnwieger in / Bleyberg unterhält. Es ist zu bedauern, daß von den Zei-/
ten, da Bamberg diese Güter besessen, so/wenig Schriften und Urkunden
vorhanden sind, / und eben auch dieser Mangel ist Ursach, daß / man von dem
Alter, Anfang, Vergrösserung / und übrigen Veränderungen dieses Bergwerks /
nichts sagen kann, als was man noch aus / wenigen vorräthigen,
unzusammenhangenden, / und zum grösten Theil unleserlichen Schrif-/ ten mit
vieler Mühe ausfindig machen / konnte.
2) Nach Grundzahlen ist meist (nicht immer) ein
Punkt gesetzt.
Von dem Fuß der Villacheralpe, nem/ lich von
Vellach, ausser Villach wo viele Eisenhämmer sind, bis an das Querthal, /
welches das Bleybergerthal mit dem Gail-/ thal vereinigt, findet man eine
Grube nach / der andern, Es scheint auch ganz natürlich / zu seyn, daß sich
der Bergbau vom Fuß des / Gebürgs weiter in das Thal verbreitet ha-/ be, und
man kann zuverläßig schliessen,
41. daß / die Gruben, die am Fuß des Gebürgs lie-./. gen, ganz gewiß die
ältesten sind, weil man / von ihrem Bau, Verhauungen, und sogar /
Auflassungen, in den ältesten Schriften keine / Spur antrifft, und ihr
Andenken sich sogar / in der Tradition verlohren hat. Von Vellach, welches
eine halbe Stund / ober Villach an der Traa lieget, und dessen / Eisenhämmer
von einem Wasser getrieben wer-/ den, das aus der Villacheralpe entspringt,
/ erhebt sich ein aufsteigender Hügel, der sich / weiter oben an die
Villacheralpe anschliest, / und als ein auslaufendes Vorgebürg dersel-/ ben
angesehen werden kann. Die ersten Gruben wurden nun vermuth-/ lich in diesem
Vorgebürg angeschlagen, und / zwar die tiefsten ganz am Ufer der Traa. So /
findet man in einem alten Protokol vom / Jahr 1558. daß neben den alten
Grüben an / der Traa bey St .Martin , einer Pfarrey / gleich ausser Vellach,
wiederum neue empfan-/ gen wurden. Sodann ist ausser den lezten / Häusern zu
Vellach hinter dem Kalvariberg / ein alter Stoln, oder Verhauung vom Tag /
hinein, die dem Streichen dieses Vorgebürgs / nachgetrieben, und wie die
Leute bezeigen / die diese Zeche befahren haben, sehr mächtig / und weit ins
Gebürg verhaut seyn soll. / Etwas weiter hinauf an der Bleybergerstras-/ se,
so die sich am linken Abhang dieses Vorge/ bürgs bis zum heil. Geister Dorf
ziehet, / noch
42. mehr aber rechts an den steillen Ab-./. hang dieses Gebürgs, nach
welchem sich die Gänge verflechten, und der Hauptbau befind-/ lich war,
sihet man viele Halden alt verfall-/ ner Gruben, die aber schon gänzlich mit
/ Dammerden überwachsen, und schon sehr un-/ kenntlich sind. Vermög
Protokoll vom Jahr / 1535. sollen neben den anderen alten Gru-/ ben ober der
Vellach auf der Ttraten, wel-/ ches eben die alten Grüben an der Bley-/
bergerstrasse sind, von denen ich diesen Au-/ genblik Meldung machte, drey
neue mit Na-/ men, Drommel, Geigen und Lauten empfangen worden seyn. Links
weiter am Bleybergerweg bis / zum Dorf beym heil. Geist genannt, wel-/ ches
auf der höchsten Anhöhe dieses Vorge-/ bürgs lieget das sich hier an die
Villacher -/ alpe an. schliesset, sieht man einige alte Bin-/ gen, wovon
eine sich links neben den Weg / in der Wiese befindet, von deren Alter aber
/ nichts bekant ist. An dem rechtseitigen Abhang dieses Vor-/ gebürgs aber,
der bis in Graben, in den / ein Bächgen von Bleyberg fliesset, eine be-/
trächtliche Seigerteyffe einnimmt, sind bis un/ terl das Dorf zum heil.
Geist mehrere Grü-/ ben, sowohl in Seiger als auch in Scherm /
nebeneinander. Man kann von ihrem Alter / ebenfals nichts ausfündig machen.
Doch ist / zu vermuthen, nachdem in den Protokollen / vom 16ten Jahrhundert
öfters von
43. der alten ./. grottischen Schmelzhütte und
Schmiede auf / der Vellach Erwehnung gemacht wird, daß / die Hrr. Grotta,
damalige Bürger zu Vil-/ lach und dermalige Grafen von Grotteneg, / mit den
Grüben auf der Vellach und in die -/ sem Gebürg verantheilt waren, und ihre
Erzte / auf dieser sehr bequem gelegenen Schmelzhüt-/ te aufschmolzen. Man
siehet auch aus eben / diesen Protokollen, daß diese Schmelzhütte / das 16te
Jahrhundert hindurch wenig oder / gar nicht mehr gebraucht, und nur von ei-/
ner Hand in die andere mehr der Schmieden / als des Werkgadens halber immer
unter den /Namen der alten grottischen Schmelzhütte / verkauft wurde. woraus
man, und weil / von keiner anderen Schmelzhütte in den Pro-/ tokollen eine
Meldung geschieht, zuversichtlich / schliessen kann, das die Grüben in den
Vel-/ lacher und heil. Geistergebürg schon im 15ten/Jahrhundert gänzlich
verhaut gewesen seyn / müssenn. Zulezt da diese Schmelzhütte so lan-/ ge
ungebraucht stunde, wurde Sie im (Jahr / 1599. von dem damaligen Besitzer
Wolf-/ gang Seeman Burgern zu Villach, aber-/ mals unter den Namen der alten
grottischen ,/ Schmelzhütte auf der Vellach samt Schmie-/ de, Kohlbahren,
und aller Zugehörde mit / Berggerichtlichen Vorwissen einem gewissen /
Joseph Winter Pappiermacher aus Brau-/ nau in Beyern verkauft, der sie aus
einer
44. ./. Schmelzhütte zu einer Pappiermühle meta-/
morphosierte, welche Gestallt sie noch heuti-/ ges Tags besizt. Der Erzthau
muß in diesem Gebürg sehr / beträchtlich gewesen seyn, indem in den Grü-/
ben ausserordentliche Verhauungen anzutreffen / sind, in denen das Erzt bis
zu Tag aus ver-/ haut wurde, und manche Zeche so groß ist,/ daß einige
Häuser darinnen Raum genug ha-/ ben würden. So viel man aus den damaligen
Bau / siehet, da einige von diesen alten Grüben, / auf deren Halden schon
schlagbahre Bäume / gewachsen, wiederum gewältiget worden, sind / in diesem
Gebürge zwey Gänge, deren der / eine ein Bleygang, der andere aber ein Gal-/
meygang ist. Im Jahr 1593. wurde von den Bam- / bergischen Vicedom auf
Anlangen des Wolf-/ gang Fleisch freyherrlich fuggerischen Ver-/ weser und
Bangratz Hofer der Herrn Leu-/ der Verweser für den fuggerisch -und leude-/
rischen Handel ein Erbstoln in Saaggraben / unter dem Dorf heil. Geist
verliehen, und / ihnen ein Driteltheil an Unkosten von Sei-/ ten des Bistum
Bamberg beygetragen; oder / vielmehr, das Bistum Bamberg ertheilte de-/ nen
Erbstolnsgewerken einen Frohnbefreyung / auf eine Summa, die dem dritten
Theil ich-/ rer Unkosten gleich kam.
45. Weiters vom Dorf heil. Geist ober und / unter der Strasse nach Bleyberg
sind eben-/ falls noch einige Grüben, die aber erst in / den neuern Zeiten
augeschlagen worden. Die / Alten hingegen wandten sich alhier von dem /
grossen Gebürg oder der Villacheralpe über / das Thal an das niedrigere
rechtseitige oder / dermahlige eigentliche Erztgebürg, und fingen / hier
einen neuen Bergbau an. Dieses Gebürg ist 3 Stunden lang. / Vom Anfang des
Gebürges , oder von dem / Dorf Kadutschen bis gegen Bleyberg, wel-/ ches
eine Strecke von einer Stund beträgt, / gibt es fast keine Grüben,
vermuthlich weil / die Gänge, die mit den Gebürg Paralell von / Morgen gegen
Abend ihre Directionslinie / haben, dieser Theil des Gebürges aber, nem-/
lich von Bleyberg bis in die Kadutschen, sich / gegen Nordost wendet, hier
wahrscheinlicher / Weise zu Tag ausstreichen. Der eigentliche Bergbau fängt
also aus/ ser dem Dorf Bleyberg gegen /Morgen an, / und erstrekt sich bis in
das Dorf Greit, / welches ebenfalls zu Bleyberg gehört, und / wo das oben
beschriebene Querthal das Bley-/ berger und Gailthal mitsammen verreiniget.
/ Dieses beträgt eine Streke von 2 Stunden. / Das Gebürg, welches in einer
ununterbro-/ chenen Linie fortstreichet, wird nur besserer / Unterscheidung
halber in 3 Theil agbetheilt;
46. nemlich: in den aussern Bleyberg, oder den ./. Theil des Gebürgs bey den
Dorf Bleyberg; / in Bleyberg Rötsh, oder den mittleren Theil / des Gebürgst
allwo gegenüber aus der Vil-/ lacheralpe ein Bach entspringt, der Rötsh /
genannt wird, und gegen Abend ins Greit, / von dort aber weiter ins Gailthal
seinen / Lauf nimmt; und endlich in den innern Bley-/ berg oder Greit, als
den lezten Theil des / Gebürgs, wo es sich ganz zu Ende gegen/ Nordwest
wendet, und durch oben beschrie-/ benes Querthal und vorfallendes Quergebürg
/ eine Biegung machet, wodurch das fernere / Streichen der Gänge
abgeschnitten wird. Da dieses Gebürg an vielen Stellen von / der Dammerde
entblößt ist, so konnten die Al-/ ten auch das Ausbeissen der an
verschiedenen Orten leichterdings finden. Die höchsten / Grüben am Gebürge
sind auch die ältesten, wie / man aus ihrem Bau und Verhauungen hand-/
greiflich abnehmen kann. Nach der Hand / hat sich der Bau durch die tieferen
Zubaustöln, / die-beständig einer unter den rolderen mit der / Zeit
angeschlagen wurden, bis , ins Thal ver-/ breitet, so, das dermahlen, weil
die höhern / Grüben schon von Alters her zu sehr verhaut / sind, der
beträchtlichste Erzthau und der / hauptsächlichste Bau. in der Tiefe geführt
/ wird. Es ist wahrscheinlich, däß die Alten / in der ganzen Streke
47. des Gebürgs, wo sie / immer ein Ausbeissen des Gangs oder Bley-/ spuren
antraffen, zu bauen angefangen ha-/ ben müssen; dann man findet in den
alten/Protokollen, das die Grüben in inneren Bleyberg vom gleichen Alter mit
denen in/ausserem Bleyberg sind. So sind neben dem / Weinrebenstoln in Greit,
welche Grube noch / dermalen in Rechten ist, Anno 1558. neue / Felder
empfangen worden. Allerheiligenstoln / im Fuggerthal wurde als ein altes
verlege-/ nes Gebäude Anno 1592 neuerdings belehnt, / und Anno 1600 ist
anstatt des alten verfal-/ lenen Erbstolns in Greit, beym Königen ge-/ nannt,
ein neuer, inner dem alten, unter / den Namen St. Christoph empfangen wor-/
den, dessen Andenken aber heutiges Tags / ebenfalls verlohren gegangen.
Nichtsdesto-/ weniger ist der Bau im ausserem Bleyberg / immer stärker als
im innern Bleyberg / betrieben worden. Die grössere Menge der / Grüben, die
in selben befindlichen grossen / Verhauungen, die mehrere erschrottene Gän-/
ge und hauptsächlich der Unterschied der / Erze, beweissen es hinlänglich.
Die ältesten und beträchtlichsten Gewer-/ ken, die man vermög
berggerichtlichen Proto-/ kollen, deren das älteste nur bis 1508. reichet /
ausfindig machen kann, sind die vorhinigen/ Freyherren und dermaligen Grafen
von / Fugger, die Herrn von Weitmoser, die Herrn / Lender, und Herrn Putz.
Von denen lezten/
48. führen noch zwey Schmelzhütten den Namen, ./. nemlich die Lenderund
Putzhütte, auch ei- / ne Fuggerhütte ist noch in Bleyberg, die / von ihrem
ehemahligen Besitzern ihre Benen-/ nung hat. Die Herrn Putz waren in den /
17ten Jahrhundert einer ehrsamen Landschaft / in Kärnten, - so lauten die
Protokolle -Miünz/ meister, und wohnten in der Stadt St.Veith. / das Münzamt,
das erst in diesem Jahrhun-/ dert aufgehoben worden, wurde zum derma-/ ligen
Rathhaus gemacht, und es werden / in Kärnten noch viele Münzen von diesem /
Münzamt in Sammlungen aufbehalten, die / auf einer Seite die Kärntnerische,
und auf / der anderen die Wappen der Stadt St. Veit / führen. Diese Putz
besassen auch das ausser Kla/ genfurt gelegene Landgut Pizlstetten, und das
/ Schloß Kircheineg zu Döllach in Großkirch-/ heim, und waren Gewerken zu
Bleyberg, / Obervillach und Großkirchheim. Anno 1605 / übergaben die Putz zu
Kirchheimmeg ihren/ zu Pizlstetten und St.Veit wohnenden Brü-/ dern ihren
ganzen Antheil bey den bleybergi-/ schen Bergbau, weil, wie Sie vorgaben, /
ihnen das Bergwerk zu weit entlegen wäre./ Von denen Herrn Lendern ist
nichts ei-/ gentliches mehr bekannt. Die Herrn von / Weitmoser hingegen
wohnten zu Hof in der / Gastein im Salzburgischen, und bauten nicht / allein
in Bleyberg, wo sie ihre Verweser / hielten, sondern waren auch
49. Gewerken in der ./. Gastein, Raures, und Schladming. Phi-/ lippus
Bechius eignete seine deutsche Ueber-/ setzung des Agricola, die er Ao. 1557
zu / Basel herausgabe, dem Herrn Kristoph Weit-/ moser zu, der selbesmal
seiner k.k. Majestät / Maximiliani, Rath, und wie er in der Vor-/ rede sagt,
Gewerk in der Gastein, Raures, / Schladming und Bleyberg bey Villach war.
/Man findet verschiedenes von denen Weit/ mosern, und insonderheit diesen
Kristoph / Weitmoser betreffend, in den Protokollen / von 1500 bis 1600. Von
den vormaligen Freyherrn und / dermaligen Grafen von Fugger ist es bekannt /
genug, wie viel Antheil Sie an den inner-/ österreichischen Bergwerken
hatten. Der / größte Theil von Bleyberg gehörte auch ihnen. / Vermög einem
Instrument von Ao. 1595, / welches dem Protokoll einverleibt ist, ver-/
kaufte Anton Fugger Freyherr zu Kirchberg / und Weissenhorn alle seine
Bergwerke in Ty -/ rol und Kärnten seinem Vettern Marx Fugger um 11000 fl.
Als der Bergseegen mit der Zeit abzu-/ nehmen anfieng, überliessen die
obbesagten / Gewerken den Bergbau ihren Verwesern in / Eigenthum; und so
kamen sie unvermerkt / in fremde Hände. Es ist unglaublich, was / für eine
große Menge Grüben in diesen Ge/ bürge angetroffen werden, Es sind heut zu
/Tag
50. laut berggerichtlichen Lehenbuch 532 ./. Grüben oder Feldmassen in
Rechten, der / aufgelassenen und für Alter verfalnen Grü-/ ben nicht einmal
zu gedenken. Unter denen / in Rechten stehenden Grüben sind noch viele/von
denen in den ältesten Protokollen Erweh-/ nung geschiest, und die noch heut
zu Tag / fahrtbar und im Bau erhalten werden. Da die Grubenmassen vermög
vorhini-/ ger bambergischer und dermaliger ferdinan-/ discher Bergordnung
sehr klein sind, und alle / Grüben quer ins Gebürg gegen Mitternacht, / und
folglich dem Gang ins Kreutz und nicht / seinem Streichen nach angeschlagen,
und auch / die Grubenmassen vom Alters her bergge-/ richtlich auf Stund 24
belehnt worden, so / ist es sehr leicht begreiflich, wie so eine / Menge.
Grüben hinlänglichen Raum in die/ sem Gebürge finden können. Eine Gruben
oder Stolns Masse betrug / nach vorhiniger bambergischer Bergordnung 4
Schnür oder Lehen - das Lehen / zu 7 / Klafter gegen Morgen und ebensoviel /
gegenen Abend, in Seiger aber 21 Klafter, / oder 10 1/2 Klafter über sich
und eben soviel/unter sich von Stolns Mundloch aus, sammt / der Extension in
die ewige Gänze, nach der / horizontalen Linie, gleichwie die Schacht/ maß,
die 3 Schnüre oder Lehen auf alle 4 / Winkel hatte, zu ihrer Extension die
ewige / Teuff genosse, Die ferdinandische Berg-/ ordnung kam, was die
51. Schatmassen anbe-/ langet, mit der bambergischen vollkommen,/ was
hingegen die Stolnsmassen betrift, in / soweit überein, daß sie statt 21 nur
15 / Klafter Seigerteuffe erlaubte. Weil aber / mehr Gruben sich vorfinden,
die mit bambergischer, und wenigere, die mit ferdinan-/ discher Masserey
empfangen worden; so hat / eine hochlöbl. Hofstelle Ao, 1778 durch ein /
Rescript ebenfals die 21 Klafter Seiger / Masserey zu belehnen erlaubt, und
folglich / die alten gewöhnlichen Grubenmassen bestät-/tiget. Man kann sich
dahero das Gebürg / in Ansehung der Stolnmnassen füglich als / einen Kasten
vorstellen, worinn die Grüben, / die eben so vielen Schubläden gleichen, /
Parallel nebeneinander eingeschoben sind. Da nun die Feldmassen so klein
sind, / daß der Gang nur 50 Klafter seinem Strei-/ chen, und 21 Klafter der
Seigerteuffe nach / verhaut werden darf, folglich ein solches / Feld bald
verhaut seyn würde; so sind die / Gewerken bey mehreren Grüben, und man-/
che bey mehr als 100 verantheilt. Inzwi-/ schen das in einer Grube auf Erzt
gearbei-/ tet, und in anderen auf Hoffnung gebaut / wird, werden die übrigen
gefristet; indem es / nicht möglich wäre, so viele Grüben auf ein/ mal in
der Arbeit zu erhalten. Im aussern Bleyberg sind 6 in den tief-/ feren
Grüben aber 7 Gänge abgequert wor-/ den, die alle stehende Gänge sind
52. und ein ./. Paralelles Streichen mit dem Gebürg haben./Die 4 Gänge die
weiter im hangend sind, / stehen 30 bis 40 Klafter, die 3 sich mehr / im
Liegend befindliche Gänge aber, 60 bis 70 / Klafter vonsammen ab. Im inneren
Bley-/ berg hingegen wurde nur ein einziger Gang / erbaut, der ebenfalls mit
dem Gebürg pa-/ rallel streicht, sich aber zwischen 30 und 50 / Grad von
Mitternacht in Mittag verflächt. Es werden nunmehr kaiserlicher Seits Lie-/
gendschläge getrieben, um das Gebürg bes-/ ser aufzuschliessen, weil man
zuversichtlich / hoffen kann, daß im inneren Bleyberg eben / sowohl wie im
aussern, mehrere Gänge hin-/ tereinander liegen werden. Warum aber die
Vorfahrer im inneren / Bleyberg das Liegend nicht eben sowohl wie/im aussem
Bleyberg untersuchten, und auch / den Bau auf den bereits abgequerten Gang /
nicht sehr eifrig. betrieben, mag wohl die / vorhinige Schmelzmanipulation,
die ich wei-/ter unten beschreiben werde, die hauptsäch-/ lichste Ursach
seyn. Denn da die Erze im / inneren Bleyberg sehr stark zinkisch und /
kiesig sind, die vorhinige Schmelzung aber/ in ofnen Rostherden geschahe,
und das Erzt / manches und langes Rostfeuer aushalten / mußte; so erhielten
sie davon sehr wenig / Bley, und konnten also natürlicher Weise / den
Bergbau in dieser Gegend des Gebürgs / nicht mit gleichem Vortheil, wie 53.
im aussern ./. Bleyberg betreiben, wo sie reines und sehr / reichhaltiges
Erzt erhauten. Auch heut zu / Tag ist das Ertz im inneren Bleyberg streng -/
flüßiger noch immer wie vorher zinkisch, / und an Gehalt nicht so hoch, wie
die Erzte / im aussern Bleyberg, besonders in Glok. (Fortsetzung folgt).
2. Bergbau:
53. So wie die Gänge von Morgen gegen / Abend
streichen, so streicht auch ein 15 bis / 20. Klafter mächtiger
Mergelschiefer in eben/ der Direktions-Linie und Verflächung durch/ das
ganze Gebürg im hangenden des Gangs./ Man kann also vorher keinen Gang
erreichen/ bevor man diesen Schiefer nicht durchbrochen / hat; die Erfahrung
hat aber gelehrt, dass/ der Gang nicht mehr als zwey höchstens aber / sechs
Klafter vom Schiefer im Liegend entfernt sey. Diese Eigenschaft, daß er den
/ Gang durch das ganze Gebürg so getreulich/ begleitet, hat ihm den Namen
des Gangschie-/ fers erworben, und dienet den Bleybergern zur Richtschnur
ihres Baues, Im aussern/ Bleyberg liegt nur ein Schiefer, im innern/
Bleyberg aber deren 3 vor den Gang, wo-/ runter der letzte der Gangschiefer
ist. Das Hangend und Liegend der Gänge/ besteht im aussern Bleyberg aus
einerley Kalk-/ stein, nemlich ex lapide calcario aequabili/ albo Wallerii.
Und einige Kalkspat-Adern/ nebst einem rothbraunen mergelartigen Letten/
können noch die wesentlichsten Kennzeichen/ abgeben. Im inneren Bleyberg
hingegen./.
54. unterscheidet man den Gang dadurch, dass/ das
Liegend aus obigen weissen Kalkstein/ das hangend aber aus grauen, ex lapide/
calcaric aequabili griseo Wallerii besteht. Die Gänge sind im aussern
Bleyberg/ alle stehend, im inneren Bleyberg hingegen/ flach; das besonderste
aber ist, daß diese/ Gänge nicht ihrem Streichen sondern nur ih-/ rem
Verflächen nach edel sind. Das ist:/ es fallen verschiedene einige Klafter
mächtige/ Streiffe in einer dem Verflächen des Gangs/ diagonalen Linie vom
höchsten Gebürg bis/ in die Teuffe nieder, die man Erztflächen/ nennet, und
sich auf 30 bis 50 Grad verflä-/chen. Sie fallen im aussern Bleyberg von/
Morgen gegen Abend, im inneren Bleyberg aber von Abend gegen Morgen. Diese
Ei-/genschaft, daß die Gänge nicht ihrem Strei-/chen sondern nur
streiffenweis ihrem Ver-/ flächen nach edel sind, ist denen meisten/
Kalkgebirgen gemein, und man hat sie nicht/ allein hierlands sondern auch in
Steyermark/ und zu Annaberg in Oesterreich beobachtet./ Auf diesen
Erztflächen haben die Alten im/ aussern Bleyberg sehr beträchtliche Verhauun/
gen zum Andenken ihrer ehelilaligen Erzeug-/ niß hinterlassen, und die
Grüben die auf sel-/ ben untereinander angesetzt sind, sind in ei-/ ner mehr
als 300 Klafter hohen Seigerteuffe/ mitsammen verdurchschlägt.
55. Im Innern Bleyberg ist nebst den Bley-/ gang auch noch eine besondere
Galmeykluft,/ die sich gleich unter der Dammerde befindet./ Es ist vor
Zeiten eine beträchtliche Menge/ hievon erzeugt, und dieser Bau erst seit 40
/Jahren wegen der in Raibl erzeugten grösse-/ ren Menge von den hiesigen
Gewerken un-/ terlassen worden. Es ist noch eine Hütte / im inneren Bleyberg
vorhanden, die die/ Galmeyhütte genannt wird, und worinn ent-/ weder der
Galmey gebrandt oder aufbehalten/ wurde. Es brachen in dieser Kluft, die/
zwar nicht mehr im Bau erhalten wird, be-/ sondere Zinkspatdrusen und
Kristallisationen,/ die für die Mineralogen noch vor kurzem ganz/ neue
Erscheinungen waren. Man kann die gesegneten Jahre, die/ Beträchtlichkeit
der Erzeugniß und Ausbeut ,/ und den Aufnahm des Bergbaues, so wie im/
Gegentheil auch dessen Verfall nicht eigentli-/ cher und deutlicher
beurtheilen, als wenn/ man von einem Werke ein Verzeichniß von/ einer
hundert und mehr jährigen Erzeugniß/ vor Augen legt. Ich liefere dahero
eine/ vom Jahre1553, soweit ich sie nemlich habe/ ausfindig machen können,
bis auf die derma-/ ligen Zeiten.* (.siehe Tabelle auf S. 63!' H..Mx.).
56. Das 16te Jahrhuhdert war also für/ Bleyberg ein sehr gesegnetes Sekulum,
und/ man wird weiter unten bey Beschreibung der/ vorhinigen und dermaligen
Schmlelzmanipu-/lation sehen, wie weit die Erzeugniß an/ Erzt vom 16ten
Jahrhundert auch unsere/ gröste Erzeugniß der letzteren 10 Jahre/
überstiegen, und wie viel im Gegentheil bey/ der vorigen Schmelzung in
Ansehung der/ dermaligen Art an Bley verlohren gegangen,/ indem aus der
Menge des vorigen Jahr-/ hunderten verschmolzenen Erztes wenigstens/ noch
einmal so viel an Bley hätte erzeugt/ werden können, wenn selbes Flammofen/
wäre aufgeschmolzen worden. Hieraus, und/ aus der kostbaren Betreibung der
Stoln/ durch Schramarbeit, die nicht vor lan-/ gen Jahren noch gewöhnlich
war, nebst den/ geringen / Bleypreiß, folgt also, daß die Al-/ten, wenn sie
nicht mächtige Anbrüche, und/ einen Üeberfluß an Erzt hatten, niemal we-/der
selbe mit Vortheil erhauen noch mit Nu-/ tzen schmelzen konnten, und dahero
die min-/ dermächtigen Anbrüche und strengflüßige Erzt-/ arten ihren
Nachkömmlingen hinterlassen muß-/ten, die durch Vortheilet die ihnen die
Zeit/ an die Hand gabe, das mit Nutzen aufzu-/ arbeiten suchten, was ihren
Vorfahren ohn-/ möglich war. Die strengflüßigen Erzte,/ die die Alten mit
ihrer Schmelzmanipulation/ nicht zu guten bringen konnten, waren die ./.
sogenannten
57. grauen Erzte oder die zinkischen/ Bleyerzte im inneren Bleyberg und die
gel-/ ben Bleyspate im aussern Bleyberg. Man/ wird weiter unten bey der
Beschreibung der vorhin gewöhnlich gewesten Schmlelzungsart/ sehen, wie
wenig Bley aus 30 bis 32 cent./ grauen oder zinkischen Erzt erzeugt
wurde,/ welches die Vorfahren ungeachtet der Mäch-/ tigkeit der Erztflächen
im inneren Bleyberg/ ganz natürlicher Weise zu den Entschluß/ bringen mußte,
mehr auf den Bau in aussern/ als inneren Bleyberg zu verwenden; und/
wirklich wurden die Erzte im Greit erst nach/ Errichturig der Flammöfen zu
verhauen an-/ gefangen, weil man sahe, daß sie sich im/ selben mit Nutzen
aufschmelzen liessen, den/ gelben Bleyspat haben hingegen die Alten in/
aussern Bleyberg bey den Gängen unverhau-/ ter stehen, was aber nothwendiger
Weise/ mit dem Gang erhaut werden musste, als/ unnütz auf die Halde geworfen
und alldort/ unbenutzter liegen gelassen. /.Man findet/ daher eine Menge von
dergleichen bereits/ verwitterten gelben Bleyspat auf der Halde/ des Mathäi
Stolns im obern Klok. Nachdem zu Ende des 16ten Jahr-/ hunderts die
Erzeugniß abgenommen, und sich das ganze darauffolgende Sekulum/ hindurch
nur noch mehr verminderte, folg-/ lich die Gewerken ihren Nutzen -
58. nicht mehr fanden, sondern vielleicht gar mit Schaden ./. bauten, so
haben Sie vermuthlich ihre An-/ theile nach und nach zu veräussern gesucht,/
oder selbe glatterdings aufgelassen. So ver-/ lohren sich die Namen der
Weitmoser, Putz,/ und Lender unvermerkt aus den Protokollen/ und
Frohnbüchern des 17ten Jahrhunderts,/ und ihre Antheile fielen in fremde
Hände./Nur die gräflich fuggerische Familie bliebe/ dem Bergbau noch am
längsten, und zwar/ bis gen das 18te Jahrhundert getreu. Ohne Zweifel war
auch die Verminderung/ der Ausbeut Ursacht warum Anno 1595,/ Anton Fugger
alle seine Bergtheile seinem/ Vettern Marx Fugger verkauftet und die/ beyden
Gebrüdere Putz zu Kirchheimegg ei-/ nige Jahre darauf nämlich Anno 1605,
ihre/ Antheile ihrem zu Pitzelstetten und St.Veit/ wohnenden Brüdern
überliessen. Dann die-/se genossen. (Textstelle leider im Druck nicht
erkennbar!!) die grossen Ausbeuten von 1572/ bis 1577, und wollten
vemuthlich die Sum-/men, die ihnen diese Jahre hindurch so reich-/ lich
zuflossen, nicht wieder in die bereits im-/ mer mehr und mehr versiegende
Quelle zu-/ rückgiessen. Von der Erzeugniß mußte den Bißthum / Bamberg 10 p.
cto Frohn in natura abge-/liefert werden. Weil aber von einigen Pro-/ dukten
nur halbe Frohn genommen wurde / und manche gänzlich frohnfrey waren, so/
hat man, um diese Weitläufigkeit zu vermei-/ den, bey der
59. Uebergab dieses Bergwerks ./. von Seiten
Bambergs an die k.k. Mini-/ sterial Banko Hofdeputation 4"Qs Mittel her-/
ausgezogen, und fürs künftige, wie es/ auch dermalen gepflogen wird, durch/
die Bank von allen Bley 71/2 p. cto zur/ Frohn festgesetzt. Fortsetzung
folgt. „Beschreibung des Bleybergwerkes zu Bleyberg bey Villach in Kärnten“
3. Geologischer Aufbau und Mineralvorkommen.
59. Nun trift die Reihe die Stein- und / Erztarten,
die in diesem Gebürge anzutreffen / sind. Die Villacheralpe und das
Erztgebürg/ und überhaupt alle Gebürge disseits des/ Trauflußes (so wie im
Gegentheil alle jen-/seitige Gebürge Granit Gebürge sind) beste-/hen aus
blossen einförmigen Kalkstein, wel-/ ches der Lapis calcarius aequabilis
albus, / Wallerii, oder der Lapis calcarius particulis/ impalpabilibus,
Cromstettii ist. In dem in-/neren Bleyberg bricht, wie ich schon gesagt/
habe, neben besagtem weissen Kalkstein, auch/ ein grauer, Lapis calcarius
aequabilis griseus./ Wallerii, welche beyde Kalksteine den Gang/ ausmachen.
Der 15 bis 20 Klafter mächtige/ Schiefer der im hangenden des Gangs vor-/
liegt, ist die 160te Gattung des Vlallerii,/ nämlich, Schistus niger, rasura
cinereus sic,-/ cus, macer, consistentia solidiori, marga-/ceus, cum acidis
effervescens. In dem Kalkstein der Villacheralpe wer-/den keine
versteinerungen gefunden, welches/ einige auf die Gedanken brin
60. gen könnte, die-/ses Gebürg für ursprünglich zu
halten; hin-./. gegen trift man in dem Erztgebürg so viele/ Versteinerungen
an, daß man gar nicht läug-/ nen kann, daß selbes ihren ursprung einer/
Ueberschwemmung zu danken hat. Mitten/ im dichten Kalkstein werden sogar am
Gipfel/ des Gebürges eine Menge Kerne von den/ Herzmuscheln in verschiedener
Größe gefun-/ den; in dem gelben Bleyspath hat man Tur-/ biniten
angetroffen, wovon der Abt Wulfenl/ in seiner Beschreibung von diesen
Bleyspathen/ einen hat abzeichnen lassen; und in dem Schie-/ fer des
äusseren Bleybergs brechen Anomiae/ striatae, im inneren Bleyberg hingegen
der/ prächtige opalisirende Muschelmarmor, der/ in dem 3ten Band der
Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Berlin beschrieben/ ist.
Auch:giebt es ganze Steinbrüche von / braun und schwarzgefleckten
Lumachellen, die/ eine schöne Politur annehmen, und einen/ prächtigen Marmor
abgeben, die Konchylien/ sind aber so sehr verwittert, daß ihre Figur / ganz
unkenntlich ist. Das Wasch- und Han-/ delhaus in Greit ist ganz von dieser
Luma-/ chelle erbaut.
1)Zur Feststellung des Verfasser vgl. G.
Mutschlechner, Karinthin, Folge 16, S.94.
2) Die beiden ersten Teile gelangten bereits zum
Abdruck: "Karinthin", Folge 14, S. 32-42 und Folge 15. Seite 61-65.
Die Bergarten, die in den Gängen brechen/ sind
folgende." Spatum calcareum rhombeoidale album dia-/ phanum.
61. Spatum calcareum crystalisatunl album,/ crystalis diaphanis trigonis
utrinque/ pyramidatis, prismate nullo interme-/ dio. Bornii. --Crystalisatum
album pellucidum, cry-/ stalis aggregatis prismate hexaedro / planis tribus
angustioribus, tribus la-/ tioribus, apice triquetro. Bornii.
--bleystallisirter und undurchsichtiger aus/ zwo gleichen sechsseitigen
pyramiden,/ die mit ihren Grundflächen zusammen-/ stossen, und zu ihren
Seitenflächenl Dreyeck haben. Schweinszähne. --ebendergleichen mit flach
auslauffen-/ den Winkeln, unordentlich fünfeckig-/ ten Seitenflächen, und 6
kleinen ge-/ schobenen Vierecken zwischen beyden/ pyramiden. Siehe Gmelins
linnei-/ sches Natursystem, Mineralreichs 2terl Teil pag. 84 und 85. Weisser
durchsichtiger schimmernder Gyps. Himmelblauer durchsichtiger Gyps, derglei-/
chen in den Salzwerkern bricht. Schwerer Gypsspath, Tuhgspath, Weisser
durchsichtiger würflichter Gypsspath. Grünlichter durchsichtiger würflichter
Gyps-/ spath, der dem grünen sächsischen Fluß-/ spath gleicht. Weisser
undurchsichtiger rhomboidalischer/ Gypsspath..
62. Weisser lameloser undurchsichtiger Gyps-,/ spath
mit runden aufrechtstehenden La-/ mellen.
-- --mit runden aus einem Centro ent-/ springenden
und halb und ganze Ku-/geln formierenden Lamellen, worauf und/ zwischen
welchen öfters die schönsten/ weissen Bleyspathe sitzen. Bergpapier,
Bergleder, Asbestus certicosus,/ albus, flexilis, membranaceus, mem-/ branis
interdum tenuissimis, interdum/ crassioribus, paralellis Bibi impositistl
Bornii. Weisse gelbe und rothe Kreide, mit schwar-/ zen dendriten und zu
Zeiten nlit eini-/ gen gelben Bleyspathen. Von Bleyerzten giebt es folgende
Gat-/ ungen. Galena particulis cubicis majoribus) Bornii.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- minoribus)
-- -- majoribus & minoribus micans.
-- -- majoribus oblique resplendens.
-- Textura chalybea, Wallerii. Stahl-/ dichtes
Bleyerzt, vel Blumbum com-/ pactum continuum albo caerulescens./Bornii.
Dasjenige Erzt welches zinkisch ist,/ ist mehr grau, welcher Unterschied im/
Schlich merkbarer als in Stuffen in/ die
63. Augen fällt.
Das weisse Bleyerzt im innerem Bley-/ berg hält im Durchschnitt 75. p. cto/
am Bley, und das graue oder zinki-/ sche alldort 56. das Bleyerzt im aus-/
sern Eleyberg aber und forderst von/ denen Grüben in Klok 80 bis 82 p. cto;/
gediegenes Bley hingegen, wie Wal-/ lerius im 2ten Theil pag. .301 als
eine, / obwohlen ungewisse, Nachricht anfüh-/ ret, ist bn Bleyberg noch nie
gefundenl worden. Galena crystallisata, pyramidibus tetraedris,/ basi
conjunetis, prismate nullo inter-/ medio. Blumbum pyramidale. Pyra-/ midal
Bleyerzt.
-- -- Pyrmuidibus aggregatis superficie po-/ lita.
-- -- mit weissen Bleyspathkrystallen be-/ streit.
-- -- mit würflichten Gypsspathkrystallen/ bedeckt.
-- -- mit weisser Galmeyerde überzogen.
-- -- mit zinkspathkrystallen bestreut.
Blumbum spatosum, crystalisatum, crysta-/lis albis
pyramidatis hexaedris acau-/ libus.
-- -- Prismate & pyrarllide hexaedra. ) Bornii.
-- -- Crystalis polyedris albis )
-- -- dergleichen bleyfärbige undurchsichtige.
-- -- mit eingekehrten Winkeln.
64. Bleyfärbige undurchsichtige paralellogrammi-/
sche am tafelf'drriligen Rand zugeschlif -/ fene Krystallen.
-- -- mit vierseitigen degenfömigen weissen/ auf
beyden Enden abgestumpften Kry-/ stallen. Zwey entgegengesetzte Winkeln/
sind, wie bey einem vierschneidigen/ Degen, sehr stumpf, und die ande-/ ren
zwey sehr spitzig.
-- -- von dreyseitigen schwarzen Pyramiden ohne
Prisma, schwarze Bleyspathkry-/ stallen genannt. Diese schliessen am/ Tag
nach vorhergegangener Verwitte-/ rung an, und scheinen schwarz, weil/ sie
auf einem schwarzen oder dunkel-/ braunen Bleyöker sitzen; betrachtet man/
sie hingegen mit einem guten Vergrö-/ ßerungsglas, oder hält sie horizontal/
für das Aug, so zeigen sie sich weiß. Gelbe. lamllose, durchsichtige,
aufrechtste-/ hende Bleyspathkristallen von nachste-/ henden Figuren.
--achteckigte dünne durchsichtige Lamellen
-- -- -- mit lichterem Rand
-- -- -- mit dunklerem Rand
-- -- -- mit einem vierecktigten lichten/ Mittelfeld
dessen Ecken sich an/ die breite Seite der Krystallenl schliessen.
-- -- -- ebendergleichen mit einem dunk-/ lern
Mittelfeld.
65. Gelbe achteckige dicke undurchsichtige Lamel-/
len mit abgeschliffenen Rand. Diese sitzen meistens auf krystallisirten/
Kakspath, und sind von selbem theils/ zum Theil, theils gänzlich inkrusirt.
An diesen Krystallen kann man auch/ die eigentliche und überhauptige Figur /
der gelben Bleyspathe am besten ab-/ nehmen. Dann wer sehr viele gelbe/
Bleyspathe gesehen hat, wird wissen,/ das diejenigen Krystallen, die
einzeln/ stehen, entweder würflicht, meistentheils/ aber lamellos achtseitig
sind, woraus/ folgt, daß hauptsächlich nur diese 2. Figuren dem gelben
Bleyspath eigen, / die übrigen aber nur zufällig, und/ entweder aus Mangel
eines hinlängli-/ chen Raums oder aus Zusammenhäuf -/ fung und
Zusammenfliessung mehrerer/ Krystallen entstanden sind.
-- -- ebendergleichen mit gleichgroßen Sei-/ ten,
und auf beyden Seiten konvexe,/ insgemein linsenfömige genannt.
-- -- viereckigte durchsichtige dünne La-/ mellen
mit hellem Rand.
-- -- -- mit dunklern Rand
-- -- -- mit einem viereckigten rothen / Mnittelfeld.
-- -- -- mit einem dergleichen schwarz-/ zen
Mittelfeld.
66. Gelbe rhomboidalische von vorhergehenden/
Gattungen. --kubische undurchsichtige grosse und kleinel Krystallen.
keilförmige dicke undurchsichtige.--
-- kleine gelbgrüne vielseitige zusammengehäuf-/ te
Krystallen.
-- Lamellen von irregulärer Figur und von/ der Größe
eines Hellers bis zur Grö-/ ße einer flachen Hand, welche mit ei-/ ner
rothbraunen Mergelerde zusammen/ verbunden sind.
-- nadelförmige, hievon ist erst ein einziges/ Stück
vorgekommen, welches wie alle/ übrige gelbe und weiße Bleyspathe von/ Abt
Wulfen beschrieben und abgezeich-/ net worden. Rothe lamellose, und Rothe
pyramidenfömige Bleyspathkrystallen. Die gelben Bleyspathe sind eine
Verlassen-/ schaft der Vorfahrer. Sie sind am häufig-/ sten im Mathei Stoln
im aussern Bleyberg/ beynahe in der mittleren Höhe des Gebür-/ ges
gebrochen. Auf der Halden dieses Ma-/ thei Stolns liegt fast kein Stück,
worauf/ man nicht dergleichen verwitterten Bleyspath/ siehet. Die Alten
müssen also diese Gat-/ tung Erzt entweder nicht gekannt, oder wel-/ ches
noch wahrscheinlicher ist, mit ihrer/ Schmelzr maipulation nicht haben zu
guten/ bringen können.
67. weswegen sie dasjenige, ./. was in Gesellschaft
anderen Bleyerztes er-/baut wurde, als taub und unnütz auf die / Halde
warffen; das übrige aber, was eben/ nicht nötig zu verhauen ware,
unberührter/in der Grube stehen liessen. Sie halten 45/ bis 50 Pf. am Bley.
Von Zinkerzten kommen folgende Gat-/ tungen vor. Galmey weisser
feinschaliger dickschaliger erhärteter derber getraufter Zinkspath
geträufter kalzedonartiger mit glasartiger Oberfläche mit gefärbten
Streiffen Krystallisirter mit paralellopedischen weissen konzentrischen am
Ecken abgestumpften durchsichtigen Kry-/ stallen dergleichen grünlichten
-- -- dicken undurchsichtigen
-- -- zusamuengeflossenen drusti-/ gen.
Blende krystallisirte
bräunlichte
gelblichte
röthlichte phosphoresirende
68. Diese Gattungen brechen sammentlich in/ den
Gruben im inneren Bleyberg./Es ist daher kein Zweifel mehr, daß es/
Zinkspath und zwar krystallisirten Zinkspath/ gebe, obwohlen in den
deutschen von Gmel-/ lin übersetzten linneischen Natursystem len Bandes pag.
424. gesagt wird: Zinkspath/ sey nur ein Gesicht des Herrn von Justi,/ das
nach ihm keiner gesehen hat; vielmehr/ ist dieses Gesicht dermalen nicht
mehr neu,/ indem schon einige Zentner von diesen Zink-/ spathkrystallen in
verschiedene Mineralienka-/ bineter verschickt worden. Das Quergebürge,
welches sich im in-/neren Bleyberg an das noch weiters fort-/ streichende
Erztgebürg anschliesset, das bley-/ berger Thal abschneidet, und selbes
gegen/ Mittag mit dem Gailthal vereinigt, und/ etwann eine Stund in der
Länge beträgt, besteht aus ganz anderen Gesteinsarten, als/ die übrigen
umliegenden Gebürge, die alle/ Kalkgebürge sind. Der Grund ist rotherl
Sandstein, auf welchen Trapp aufgesetzt ist./ Dieser Sandstein wird in
Bleyberg zur Oe-/ fenmaurung und Schleifsteinen verbraucht./ In und bey den
Bach hingegen, der durch/ dieses Querthal fliesset, liegen eine Menge/
verschiedener Saxa composita und Quarzstucke,/ wovon man doch in keinem
vorliegenden Ge-/ bürge einen Bruch siehet. Man findet dort./.
69. Quarzum purum album. Bornii. wel-/ cher phosphoresirt, wenn manf zwey
Stücke zusammen reibt. Den bayrischen Granit, aus grünlich-/ ten Quarz oder
vielleicht Schma-/ ragdmutter mit kleinen rothen durch-/ sichtigen Granaten.
Grüner Scherl_, weisser Glimmer, und/ rothe Granaten, welcher dem obi-/gen
dem Ansehen nach nicht un-/ gleich ist. Grüner Scherl und Quarz. Hornblende
und Glimmer. Grünstein.
Mandelstein; rother Jaspis mit Ser-/ pentinhöllungen.
-- rother Jaspis mit Serpentin und/
Kalkspathhöllungen. Eine Quarz-Breccia, die Herr Hofrathf von Born
beschreibt; Brecciamf quarzosam fragmentis quarzi puri,/ micae argentatae &
basaltis nigri,/ argilla cinerea conglutinatis; ist/ der gewöhnliche
Mühlstein bey den / bleybergischen Ertzmühlen Serpentinfels aus Serpentin
und Kalkspath aus Serpentin und Jaspis. Es ist mir jederzeit wunderlich
vorge-/kommen, daß in den Bächen und Grüben/ der Kalkgebürge eine Menge
glasartige/
70. Steine, Saxa composita und preccien ange./. troffen werden, wo
man hingegen in denen/ Granit Gebürgen niemalen Kalktrümer fin-/ det.
Diejenigen Naturforscher, die die Na-/ tur Begebenheiten in ihren Zimmern
erklä-/ ren, ohne sich die Mühe zu nehmen die ver-/ schiedenen Werkstätte
derselben zu besehen, nehmen ihre Zuflucht zu Ueberschwemmungen/ und
glauben, weil die Granit Gebürge für/ die höchsten. angenommen werden, daß
diese/ Steinarten von dorther durch ehemaligel/Wasserfluthen übertragen
worden. Allein/ Leuthe, die eine Menge Gebürge mit Auf-/ merksamkeit besehen
und bestiegen, und deren/ gegenseitige Lage mit Ueberlegung betrachtet/
haben, können dieser Meynung nicht so glat-/ terdings beystimmen. Durch
Ueberschwem-/ mung müßten ebenso wohl Kalktrümmer auf/ den Abhang und Grüben
der Granitgebürge/ seyn geführt worden, als es möglich ist, / das
Granittrümer, auf Kalkgeblirg übertra-/ gen wurden. Aber auch Granittrümer,
die/ der Meynung doch einige Wahrscheinlichkeit/ mittheilten, sind es nicht,
die man in den/ Kalkgebürgen findet; sondern einzelne Quarz-/ stücke,
zusammengesetzte Steine, und Breccien,/ wovon man weder in Granit- noch
Kalkge-/ bürgen einige Anbrüche ausfindig machen/ kann. Vielleicht bin ich
einmal im Standet,/ nach mehreren Untersuchungen die ich dieser-/ wegen
alles Fleisses anstellen werde, et-/ was zuverlässiges zu sagen. Indessen
kann ./. diese eingestreute Erinnerung denen Naturfor-/ schern Anlaß geben,
ihrer Gewohnheit gemäß/ Hypothesen zu schmieden. Schluß folgt. "Beschreibung
des Bleybergwerks zu Bleyberg bey Villach in Kärnthen".
4. Verhüttung:
Seite 71. Die Aufbereitung der Erzte geschieht in /
Bleyberg auf eben die Art, wie in anderen / Bergwerken. Die Stuffen werden
mit Men-/ schenhänden zerpocht geschieden, und durch 3 / Siebe nemlich das
Kernsieb, Schlammsieb, / und Ueberhebsieb, gesetzt. Das geringhal-/ tige, so
von diesen 3 Sieben zurück bleibt, / heissen die Kleben. Wie nun dieses in
an-/ deren Werkern auf die Pochwerke gebracht / wird, so liefert man es hier
auf die Erzt-/ mühlen, die allda die Stellen der Pochwer/ ke vertreten. Man
hat aber kaiserl. Seits angefan/ gen sowohl ein trocknes als auch nasses /
Pochwerk zu erbauen, um die gar zu armen / Erzte durch letzteres
vortheilhafter zu Guten / zu bringen, und auf ersteren den gar zu / grossen
Abgang bey rauhen Erzten, der sich / bey Erztmühlen zeigt, zu ersparen. Die
Erzmühlen sind von der nemlichen / Struktur, wie die Getraidmühlen, und das
/ Erzt wird zwischen 2 Steinen wie das Ge-/ traid, nach beliebiger Größe
gemahlen. Es / kommen auf diese Mühle sowohl ganz Erzte, / oder gediegene
Erzte, als auch eingesprengte, / geringhaltige, oder Pochgänge. Die Erste/
ren werden geschwinder und gleichförmiger / zu Erbsen Größe gemalen,
72. als sie mit Men-./ schenhänden zu eben so
gleichförmigen Theilen / geschieden werden könnten: Bey den zweyten / läßt
sich das Erzt von der Gangart, weil. / beyde sehr weich sind, leichterdings
abson/ dern; die dritte Gattung wird, weil zu viel/ Gangart darunter ist, zu
Schlamm gemahlen, / durch das Schlammsieb durchgelassen, und auf / den
sogenannten langen Hapt, oder einen / vor Alters gebräuchlich gewesenen, und
im / Agricola Seite 242 bis 246, abgezeichneten / schmalen Waschherd
gewaschen. Doch der/ malen werden die geringhaltige Erzte wohl/ feiler auf
den nassen Pechwerk gepocht und / auf ungarischen Schlammherden gewaschen.
Was der Erztmühl und dem Waschherd / bey der Manipulation entgeht, wird in /
Sümpfen aufgefangt, und wiederum zu Gu-/ten gebracht. Damit die Erzte nach
beliebiger Größe / gemahlen werden können, kann der obere / Stein oder
Lauffer mehr oder weniger erho/ ben werden. Die Erzte werden gemeiniglich in
Größe / der Erbsen gemalen weil die Erfahrung/lehrte, daß sie in dieser
Größe in den Flamm / ofen am leichtesten aufzuschmelzen wären. In einem
Monat werden auf einer / Erzmühl 3500 Centner Pochgänge oder ge/
ringhaltiges Erzt gemahlen, Gangerzte aber / ungleich mehr.
73. Der Vortheil einer Erztmühl in Anse/ hung eines
Pochwerks bezieht sich erstens auf / die Geschwindigkeit, zweytens auf die
Schmelz- / zungsart im Flammofen. Denn da erfordert / wird, daß der
Schmelzschlich Erbsen Größe / erhalten soll; so kann dieses durch eine Müh-/
le zuversichtlicher als durch ein Pochwerk be-/ werkstelliget werden. Die
Pochwerks Ma-/ nipulation hingegen ist ungleich wohlfeiler / und erfordert
nicht soviel Personale. Das in Erbsen Größe aufbereitete ganz / und
Miittelerzt welches Kern oder Schmelz/ schlich genennet wirdt oder auch der
Schlamm / von Pochgängen, werden sodann in die / Hütte zur Verschmelzung
geliefert. Bis auf 1735 beyläufig war noch die / alte im Agricola
beschriebene Schmelzungs-/ art gewöhnlich. Auf den 329ten und 33oten / Blat
sieht Dan sowohl die Beschreibung des / Schmelzprocessest als auch die
Zeichnung des / Ofens. Die Erzte wurden erstens in großen / Stücken im
offenen Feuer auf Rostherden, / die man Brandherde nanntet von Abendl bis
Morgens durch 12 Stunden gebrandt. / Alsdenn mit Menschenhänden gepocht, ge-/
malen, und hievon 32 Centner zur Vormaaß / auf den sogenannten Rostofen oder
eigentli/ chen Schmelzofen genommen. Dieser Ofen hatte rückwärts eine vier/
eckige Oefnung, durch die das Erzt hinein./.
74. geworffent und der Ofen angefeuert werden /
konnte. Von vorne aber war er geschlossen, / und die Mauer, die den oberen
und untern / Theil des Ofens absondertet hatte längst / des Ofens in der
Mitte eine Oefnung, auf / Art eines Seigerherds t damit das im Fluß /
gebrachte Eley sogleich in den untern Theil / des Ofens fallen konnte. Auf
diese Mauer oder den eigentlichen / Ofenherd wurde nach der quere dickes
grünes / Holz gelegt, welches man den Boden nann/ te, und darum aus grünen
Holz be/ stand; damit es nicht so geschwind durchbren- / nen sollte, Auf das
grüne soll eine Lage / dürres Holz, darauf das Erzt und sodenn / wieder eine
Lage von dürren Holz. Diese loberste Lage wurde hierauf durch die hin- /
tere viereckigte Oefnung angefeuert, und im/ mer so, wie das Holz nach und
nach ver/ brandte, neues nachgeworffen. Sobald nun / das Erzt geschmolzen
war, fiele das Bley / durch die Oefnung in den unter Theil des / Ofenst der
abhängig dicht von Leimen ge-/ schlagen war, und worauf es bis in den /
ausser den Vordertheil des Ofens befindlichen / Tiegel lief. Das Bley, so in
diesen Rost-/ 5fen erzeigt worden, bekame den Namen / -Jungfernbley, und
wurde, insonderheit von / Scheiben-Schützen, für besonders bewährt /
gehalten.
75. Eine dergleichen Schmelzung oder Ein/ fahrt
dauerte mit guten Erzt oder weissen / Schlich 24 Stunden mit grauen
zinkischen / Erzt aber wohl zweymal so lang. Das Grätz, wovon in diesen
Oefen / nicht wenig zurück bliebe, wurde wiederum / gepocht, gemalen, und
auf einen unförmli-/ chen Stichofen in 12 Stunden ausgeschmol / zen. Vom der
ganzen Vormaaß der 32 Cent. / Erzt erhielten die Gewerken aus den Rost-/ und
Stichofen zusammengenommen von weissen / Schlich 10 höchstens 15 Centner und
von / grauen Schlich aber 6 auch weniger Centner an Bley; ja es gibt sogar
Beyspiele, daß / mit den aus grauen Schlich erzeigten Bley / nicht einmal
das verbrandte Holz bezahlt / werden konnte. So haben einmal Lorenz
Tschoitsch und Bartl Brunner einen Brand / von 32 Centner grauen Schlich
vorgerichtet, / wozu ihnen das Holz 4 fl. 30 kr. kostete. / Sie erhielten
aber nicht soviel an Bley, als / der Werth des Holzes betruge, sondern,-wa/
ren gezwungen, noch 1 fl. 30 kr. in baaren darauf zu zahlen.
Man beliebe
sich allhier desjenigen zu / erinnern, was ich oben erwähnte, so wird / man
deutlich überführt, daß nur der unglei-/ che Ausfall im Schmelzen in
Ansehung des / weissen Schlichs von aussern -und des grauen / von inneren
Bleyberg
76. die Baulust bestimm-./. te, und das eben darum die Grüben / im
inneren Bleyberg lange nicht, so wie die / im aussern betrieben worden, wo
doch seit / der Einführung der Flammöfen, in denen / sich der graue Schlich
ungleich besser benutzen / läßt, die Grüben in Greit viel stärker belegt /
und schon seit geraumer Zeit beinahe 2/3 / Theil von der ganzen
bleybergischen Erzeug-/ niß den dortigen Grüben erhaut worden. Diese
Schmelzart war für die Wald-/ kultur sehr schädlich, indem zu den Brand-/
herden und Rostöfen sehr viel junges Holz / verbraucht wurde; auch der
Konsumo des / Holzes war ungleich größer als dermalen, / weil das Erzt 3
Feuer aushalten muste, wo anjetzo nur eines erforderlich ist. Damungeacht
war diese Schmelzmani-/ pulation seit undenklichen Zeiten im Gebrauch; / bis
vor beyläuffig 45 Jahren ein Bleyber -/ gischer Gewerk mit Namen Mathias
Tanzer / den ersten Flammofen in seinem eigenen Haus / errichtete, und durch
Einführung dieses Ofens / der Gewerkschaft einen ausserordentlichen Nu-/
tzen, und sich selbst ein unsterbliches Anden-/ ken verschafte. Der hier
beygefügte Grund- und Auf-/ riß in der Zeichnung nebst der Erklärung /
seiner Theile wird hinreichen, die Structur/ dieses sehr einfachen Ofens bey
den ersten / Anblick begreiflich
77. zu machen, und ich kann ./. mich also ohne
weiteres zur Beschreibung der / Schmelzungsart selbst wenden. Eine Vormaaß
oder Einfahrt, wie Sie / in Bleyberg genennt wird, besteht aus 3/ Centnern
von der Aufmachstadt oder Waschwerk / erhaltenen Reinschlich, hat man auch
Schlam-/ schlich, so vermischt man 1/3 von diesem mit / 2/3 von jenem. Wenn
der ohnehin von der / vorigen Einfahrt annoch im Feuer stehende / Ofen in
etwas abgekühlt ist, werden die 3 / Centner Schlich mit einen Seztrögl durch
/ das Mundloch im Ofen geworffen, und bey-/ nahe durch eine halbe Stund lang
in selben / ruhig liegen gelassen, damit sich das Erzt / erwärme, und
zugleich eine kleine Röstung/ vorgehe. Nach dieser Erwärmung und Ver-/
röstung wird der Schlich durch eine eiserne / Rührstange soviel möglich
ausgebreitet, der / Ofen zu heitzen angefangen, und die Hitze / immer
verstärkt. In einer Zeit von 1 1/2 Stund fängt das Erzt zu schmelzen, und /
das Bley zu fliessen an, welches mit der / nemlichen Hitze 8 Stunden
hindurch andau-/ ert. Nach Verlauf dieser Zeit, da das mei-/ste aus den Ofen
geflossen, wird die Hitze bis / zu Ende der Einfahrt auf das höchste ver -/
stärkt, und zugleich in den Ofen selbst Koh-/ len und Bränder
hineingeworffen, wodurch / nicht allein das übrige wenige in Erzen bei
findliche Bley noch heraus-
78. geschmolzen, son-/ dern auch die kalcinirten
Theile wiederum ./. reducirt werden. Die ganze Zeit über muß / der Schmelzer
das Erzt mit der Rührstange / immer zurühren fortfahren. Ist nun be-/ reits
alles Bley geflossen, welches meisten-/ theils in der 11ten Stund geschiehet,
so / wird das Bleyt welches währenden Schmel-/ zen in eine unförmliche
eiserne Pfanne fließt, / und sich theils auch in Klumpen am Sei-/ gerstein
ansetzt, noch einmal im Ofen ge-/ worffen, um selbes herum Feuer gemacht, /
zerschmolzen, und in eine förmlichere Pfan-/ ne -Rennpfanne genannt
-gelassen; wo / es alsdann die Figur und den Namen einer / Blocke erhält ,
von dem Frohnwieger ab -/ gewogen, das Gewicht darauf geschlagen, / und als
ein fertiges Kaufmansgut endlich / verschliessen wird. Von weissen Schlich
wird eine Einfahrt / in 11 bis 12 Stunden; von grauen Schlich / aber in 12
bis 13 Stunden ausgeschmol-/ zen. Zu einer Einfahrt wird 1/4 Wiener /
Klafter 5 Schuh langes weiches Holz und 2 / Seztrögel voll Kohlen zur
Ausarbeitung, / oder noch besser zu 5 Einfahrten ein Wiener / Klafter Holz
verbraucht. Ein Schmelzer verbleibt durch 24 Stun-/ den oder durch 2
Schichten in der Arbeit. Die Schmelzkösten belauffen sich bey ei-/ ner
Einfahrt dem Mittel nach auf 1 fl. 40 kr.
79. Vermög den Mittel aus allen Schmel-/ zungen der
sammentlichen Einfahrten werden / aus 3 Centner oder einer Einfahrt Schlich
2 / Centner 3 bis 5 Pfund Bley erechmolzen. Der graue Schlich hält 56 bis 60
ft der weisse aber 75 bis 80 Pfund Bley. Von ersteren ist 10 p., Cto. von
letzte-/ ren aber 6 p. Cto. Schmelzabgang oder / Feuerverbrand. Von grauen
Schlich bleiben oagefähr / bey 55 von weissen hingegen 45 Pfund an / Grätz
zurückt dessen Gehalt sich von 5 bis / 10 Pfund an Bley belauft. Das Grätz
wird wiederum gepocht, ge-/ mahlen, durch die Sieber gesetzt, gewaschen, /
und sodann neuerdings auf den nemlichen / Flammofen verschmolzen. Das Erzt
ist in Erbsen Größe am leich-/ testen im Flammofen zu behandeln , dann in /
Körper eines größeren Umfangs kann die / Hitze der Flamme schwerlich
eindringen, und / auf kleinere Körper, wie auf Schlammschliche, / wirkt sie
zu geschwind, so dass der Schlich / entweder vermög der überhauptigen
Leicht-/ flüssigkeit des Erztes, wie eine Pappe zusam-/ mensintert, oder,
wenn man dieses mit um -/ rühren verhindern will, durch den Zug der / Flamme
und der Luft beym Mundloch wie -/ der herausgeblasen wird, weswegen man /
auch niemals Schlammschlich allein ver-
80. schmel -./. zet, sondern ihn jederzeit
mit Kernschlich zu / vermischen suchet. Da das Bley sobald es im Fluß kommt,
/ über den abschüßigen Heerd sogleich in die/Pfanne lauffen kann, so kann
natürlicher / Weise davon nicht soviel in Feuer wie in an-/ deren Oefen
verlohren gehen. Aus der ungleich grösseren Ausschmel-/ zung durch die
Flammöfen, besonders in An -/ sehung des grauen Schlichs, kann man den /
ausserordentlichen Feuerverbrand der ehema-/ ligen Schmelzmanipulation
schliessen. Denn da die alten aus 32 Centner Schlich selten / mehr als 10
Centner Bley erzeugt werden; so erhellet klar, daß / die Bleyausbringung
durch die Flammöfen / um noch einmal so hoch gestiegen; und das / die alten
eben soviel Bley bei ihrer Schmel-/ zung verbrandten als sie erschmolzen.
Wenn/ man hierzu die oben angeführte Erzeugnißta-/ belle zur Hand nimmt, so
sieht man deutlich / das z. B. im Jahr 1475 statt 15000 Cent. / bey der
dermaligen Schmelzmethode 30000 / Centner hätten erschmolzen werden können,
/ und daß -welches zum erstaunen ist -/ eben soviel als erschmolzen worden,
nemlich 1/ 15000 Centen selbes Jahr im Rauch ver -/ schwunden sind. Wenn
dahero die Bleyber-/ ger den Nutzen, den ihnen der Mathias / Tanzer durch
Einführung
81. der Flammöfen. / .verschafte, mit Ueberlegung betrachten wollen, so sind
sie wahrlich verpflichtet, diesem wür-/ digen Manne zum Denkmal ihrer
Erkenntlich-/ keit eine Ehrensäule zu errichten. Nachdem noch viele der
Meynung sind, / daß das Villacher Bley -welchen Namen / das Bleyberger Bley
insgemein führet, weil / es von Villach aus verschließen wird -sil -/
berhaltig sey, indem nach der überhauptigen / Meynung der Mineralogen kein
Bley ohne / Silbergehalt angetroffen wird; so will ich / hier, ungeachtet
die Erzte und Grätze durch / wiederholte kleine Feuerproben untersucht, /
aber niemalen ein Silbergehalt entdeckt wor-/ den, eine Probe erwähnen, die
um-so zu -/ verläßiger ist, weil sie im Großen abgeführt / worden. Als
nemlich der Befehl ergieng, jähr-/ lich einige Tausend Centner Glett zu
erzei-/ gen, so hat man, nachdem bereits 6150 Cent. / Bley zu Glett
vertrieben worden, das von / diesem ganzen Quanto zurückgebliebene Herd-/
und Reichbley den 5ten Jänner 1776 auf / den Treibherd ablauffen lassen, und
9 Loth / 3 Quintel an Silber erhalten. Mithin wa-/ ren, wenn das Mark Silber
nach den im / Römischen Reich angenommenen kölnischen / Richtpfennig 65536
Theil gerechnet wird, / in obigen 6150 Centnern Bley 39936 solcher/ Theile
enthalten, und kommt also auf 1 / Centner Bley 1/40 Denari
82. Silber, wel./. ches freylich ein so unmerklicher
Theil ist, / der durch die kleine Feuerprobe niemal zun / Vorschein kommen
kann, und so zu sagen, / soviel als Nichts zu rechnen ist. Endlich werden
bey diesem Bergbau bey /600 Arbeiter unterhalten, die ganze Population /
aber von Bleyberg belauft sich auf 2700 See-/ len, die alle theils
mittelbar, theils unmittel-/ bar ihren Unterhalt vom Bergbau beziehen.
Vermög der angeführten Erzeugnißtabell-/ kommen auf die letzten 10 Jahre im
Durch/ schnitt jährlich 18000. Centner Bley, die; / zu 9 fl. der Centner
gerechnet, eine Summe / von 162000 fl betragen; folglich ist dieses /
Bergwerk für Kärnten ein Kapital von 4 / Millionen.
Erklärung der Buchstaben.
a. Die Anzicht, oder der Luftkanal 17 Zoll/in Quadrat
von innen, von aussen / aber mit Ziegeln versetzt, um nach / Belieben viel
oder wenig Luft durch/ zulassen.
b. Das Schürloch ebenfalls 17 Zoll in Qua-/ drat, um 1 1/2 Schuh tiefer als / das Mundloch.
c. Der Schlauch.
d. Die
Untersetzpfanne.
83. e. Das Bleyloch oder Ofens Mundloch hoch /14,
breit 12 Zoll und 1 1/2 Schuh /.-höher als das Schürloch.
f. Der Rauchfang.
g. Das Gewölb unter welchem sich die Fla/ me in den Rauchfang
hinüberschlingt.
h. Schürgassen, lang 10 Schuh.
i. Erstes Luftloch des
Anzugs oder Anzichts / zu Ende des 6ten Schuhs, 4 Zoll. / breit.
k. Die
übrigen 2 Luftlöcher, jedes 2 Schuh / von einander entfernt.
l. Gradmauer
zwischen Schürloch und Ofen, /3 Schuh dick.
m. Oefnung der Gradmauer,
wodurch die Flam-/ me in Ofen spielt, 6 Zoll hoch, und /6 bis 7 Schuh lang.
n. Der Ofenherd, 10 Schuh lang, 51/2/ breit und 1 1/2 Schuh hoch, bis ans / Gewölb.
o. Der Rauchfang.
p. Das Bleyloch
q. Die Rührstange.
r. Eiserne
Stange, die quer über des Ofens / Mundloch liegt, und worauf der Schmel-/
zer, die Rührstange legt, damit er sie / leichter und bequemer regieren
kann. / Diese Stange wird abgenommen, Wenn / das Erzt in den Ofen geworffen
wird.